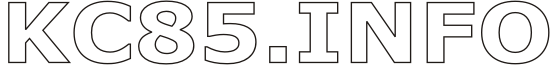Top-Themen:
- Bericht vom Vintage Computer Festival Europe v2.0
- CAOS-(Start)Diskette mit DEP 3.0
- CAOS-Dateien unter CP/M erzeugen
Ein paar Worte zur Einleitung
von Frank Dachselt
Schauen wir zunächst einmal etwas zurück. Die erste Jahreshälfte ist für Fans von historischen und exotischen Computern mittlererweile mit einigen festen Ereignissen gespickt. Für uns ist da natürlich zu aller erst das KC-Clubtreffen zu nennen, das auch dieses Jahr wieder im April stattfand. Für alle, die nicht in Naumburg dabeisein konnten, war für diese Ausgabe natürlich wieder ein Bericht geplant. Leider haben diesmal die "äußeren Umstände" beim traditionellen Verfasser dieser Berichte verhindert, daß ein solcher geschrieben wurde. Wir müssen uns deshalb mit den Bildern begnügen, die vom siebenten Clubtreffen auf dieser und den folgenden Seiten zu finden sind und zumindest versuchen, einen Teil der Atmosphäre wiederzugeben. Ich denke, ich kann es im Namen aller Teilnehmer tun, wenn ich Hendrik Wagenknecht an dieser Stelle für die aufgewendeten Mühen bei der Organisation dieses Treffens noch einmal ganz herzlich danke. Sozusagen als Ausgleich für den nicht vorhandenen Bericht vom Clubtreffen schauen wir mit Berichten und Bildern auch bei zwei anderen Events der Oldi-Computerszene vorbei.
Wer also in Zukunft ganz sicher gehen möchte, daß er nichts wichtiges und aufregendes verpaßt, der sollte beim nächsten Clubtreffen unbedingt selbst dabeisein. Damit wären wir schon beim wichtigen Punkt "zukünftige Ereignisse": Getreu dem Motto "Nach dem Treffen ist vor dem Treffen" müssen wir an dieser Stelle schon wieder beginnen, uns Gedanken über das nächste Clubtreffen zu machen. Zunächst sind also wieder einmal Leute mit Initiative gefragt, die ein solches Treffen organisieren möchten. Die wenigen Rahmenbedingungen bezüglich Ort und Termin sind sicher bekannt. Ich möchte an dieser Stelle vorschlagen, daß potentielle Organisatoren ihre Gedanken entweder selbst per E-mail den anderen Clubmitgliedern zur Diskussion stellen oder ihre Vorschläge erst einmal an die Redaktion senden, von wo aus sie dann bekannt gemacht werden. Der aktuelle Zeitplan sieht so aus, daß noch vor Jahresende eine Entscheidung gefallen sein sollte, damit mit der nächsten Ausgabe der KC-News die Anmeldeformulare verschickt werden können.
Damit sind wir beim nächsten - und dem vielleicht wichtigsten - Punkt. Die zweite Ausgabe der KC-News im September, das ist nicht gerade toll! Die Erscheinungsweise der KC-News gibt in der letzten Zeit keinen Anlaß zur Zufriedenheit. Um es vorwegzunehmen, die Ursachen sind vielfältig und liegen keinesfalls bei einzelnen Beteiligten. Ich hatte in den zurückliegenden Ausgaben bereits einiges dazu gesagt und möchte es an dieser Stelle nochmals tun. Der Hauptgrund für die niedriger gewordene Erscheinungsfrequenz der KC-News liegt im abnehmenden Beitragsstrom (gemeint sind hier die inhaltlichen Beiträge für die KC-News), der die Redaktion erreicht. Es muß schon eine gewisse Anzahl von Seiten zusammenkommen, damit es sich lohnt, eine Ausgabe fertigzustellen. Wir sind deshalb gezwungen, von den festen Erscheinungsterminen zu einem gleitenden Schema überzugehen. Trotzdem stehen im Impressum noch immer die festen Termine, die sozusagen den Idealfall darstellen, den wir versuchen sollten, wieder zu erreichen. Was jeder einzelne dazu beitragen kann, liegt auf der Hand...
Wie die häufigen Nachfragen zeigen, führt die unregelmäßige Erscheinungsweise der KC-News auch schnell zu Ungewissheit über die gezahlten Clubbeiträge. Das was bisher ein Jahresbeitrag war, reicht auch heute noch für vier Ausgaben und damit entsprechend länger. Im Zweifelsfall gibt immer die Zahl auf dem Adreßaufkleber auf dem Umschlag mit den KC-News darüber Auskunft, für wieviele Ausgaben der gezahlte Beitrag noch reicht.
Eine weitere Veränderung, die in Zukunft den Weg der KC-News wieder etwas beschleunigen sollte, ist der Aufgabenbereich Mitgliederverwaltung und Kopieren/Versenden der KC-News, den Andreas Ose bis heute übernommen hat. In dem dieser Ausgabe beiliegenden Brief schreibt Andreas selbst etwas zur derzeitigen Situation und den Lösungsmöglichkeiten. An dieser Stelle nur soviel: Wir brauchen für diesen Aufgabenbereich eine neue Besetzung, die auch durch Aufteilung aus zwei Clubmitgliedern bestehen kann. Wer Mut und Lust hat, etwas von seiner - natürlich immer viel zu knappen - Freizeit für den KC-Club aufzubringen, sollte dies im Interesse unseres gemeinsamen Hobbys tun.
Abschließend möchte allen Clubmitgliedern für ihre Geduld und ihr Verständnis danken und wünsche nun viel Vergnügen beim weiteren Lesen dieser Ausgabe.
Euer Redakteur
Bericht vom Vintage Computer Festival Europe v2.0
von Jörg Linder
Auch in diesem Jahr fand in München das Vintage Computer Festival Europe, kurz VCFE, nur eine Woche nach dem KC-Clubtreffen statt. In den Hallen des ESV München-Ost hat sich am Wochenende 28./29. April 2001 wieder alles zusammengefunden, was im Bereich alter Computer Rang und Namen hat.
Natürlich lasse ich es mir als KC-Clubmitglied nicht nehmen, mit der Ecke der "Ostrechner" zu beginnen. Enrico Grämers KC-compact war leider nur am Samstag zu bewundern, da Enrico am Sonntag anderweitige Verpflichtungen hatte. Doch umso mehr konnte sich Frank Dachselt ausbreiten. Neben seiner kompletten KC 85/4-Anlage hatte er auch den KC 87 von Reinhard Gitter dabei. Mehrfach hatte ich die Ehre, mit dem originalen Präsentationsprogramm von robotron zu interagieren. (Was sich allerdings auf das gelegentliche Drücken der Enter-Taste beschränkte.)
Außerdem hatte Frank zusammen mit seinem Arbeitskollegen Thomas Falk ein paar exotische Vertreter der DDR-Computer ausgestellt: Neben dem bekannten Einplatinenmodell LC 80 war dies der kaum verbreitete Poly 880 sowie ein qpc-1. Dieser "Quantity Process Computer" dient der Berechnung physikalischer Größen einschließlich der dazugehörigen Einheiten. Beispielsweise läßt sich der Widerstand durch Eingabe von Strom und Spannung ermitteln. Allerdings muß man darauf achten, daß das Gerät mit umgekehrter polnischer Notation arbeitet!
Mit seinen beiden Computern AC1 (Amateurcomputer 1 der Zeitschrift "Funkamateur") und JU+TE (Computer der Zeitschrift "Jugend und Technik") zeigte Thomas Falk Selbstbau-Computer der DDR-Ära. Während der AC1 wohl verhältnismäßig viele Bastler in seinen Bann zog, von dem es sicherlich noch einige "lebende" Exemplare gibt, könnte der ausgestellte JU+TE Computer möglicherweise der letzte seiner Art sein.
Gleich daneben präsentierte Julian Stacey seine Half-a-VAX. Dieser Computer, der eigentlich "The 375" heißt und von der Firma Symmetric hergestellt wurde, ist mit einer NSC 32016 CPU mit ca. 8 MHz ausgestattet. Den Beinamen erhielt das Gerät, weil sich der Entwickler einen Computer wünschte, der zumindest die halbe Leistung einer VAX hätte.
Damit kämen wir auch gleich zu den "VAXbusters International". Diese Gruppe junger, dynamischer Menschen hatte wie im Vorjahr einiges an Technik aufgefahren. Ein DECserver 300 mußte für diverse VAXstations herhalten; die ganz großen Kisten blieben in diesem Jahr allerdings zu Hause. (Angesichts des gut gefüllten Ausstellungsraums sicherlich keine schlechte Entscheidung.)
Herr Schünemann brachte ebenfalls Technik von DEC mit. Diese war jedoch schon etwas betagter und trug einen ganz berühmte Namen, nämlich PDP 8! Gleich drei Vertreter dieser Gattung waren zu besichtigen: PDP 8/L, PDP 8/S und PDP 8/A. Als Ein-/Ausgabegerät für die erstgenannte PDP 8/L war ein genauso altes Teletype Terminal mit Lochstreifen (110 Baud) in Aktion zu bewundern. Eine danebenstehende DECmate II konnte gegen so eine starke Konkurrenz natürlich kaum das Interesse auf sich ziehen.
Ähnlich erging es dem IMSAI 8080 von Hans Franke, der nicht nur größenmäßig von seiner IBM 4331 überragt wurde. Arno Kletzander hatte dieses Ungetüm vor der Verschrottung gerettet und in der Nacht vom Samstag zum Sonntag aus den Einzelteilen wieder zusammengebaut. Zweifellos war die Inbetriebnahme - oder zumindest der Versuch - ein Höhepunkt dieses Festivals.
Weiter im Rundgang stieß ich auf bekannte Gesichter. Matthias Schmitt stellte neben einem digital Rainbow (PC100) und einem digital VT180 auch den Canola 164P aus. Philip Belben war wiederum aus dem vereinigten Königreich angereist und zeigte unter dem Motto "Portable Computing" zahlreiche Geräte: eine mechanische Rechenmaschine, einen Philips P2000C, einen IBM Portable Personal Computer, einen Compaq Portable III, einen Toshiba T5200/100, einen Victor V86P, einen TRS-80 und einen Osborne. Daß "portabel" nicht unbedingt mit "leichtgewichtig" einhergeht, wird beim Anblick dieser Geräte klar. Dagegen kann man heutige Notebooks bestenfalls als "Klappstullen" bezeichnen.
Fast schon unauffällig könnte man die diesjährige Ausstellung von John Zabolitzky nennen. Gemessen an seinem riesigen MUNIAC im Vorjahr nahmen sich sein 4-Bit-Zähler in Relaislogik und die SUN Sparcstation 1 geradezu bescheiden aus. Auf einer weiteren Tafel zeigte John die Entwicklung von Logik-Modulen in der Zeit von 1955 bis 1995. Überwiegend war er allerdings mit den Besichtigungstouren beschäftigt, die zu seiner CDC Cyber 960 und seiner Cray YMP-EL sowie weiteren Schätzen führten. Leider war es mir nicht vergönnt, an einer Tour teilzunehmen, aber vielleicht habe ich ja bei einem der nächsten VCFE die Gelegenheit, eine echte Cray zu streicheln.
Andreas Böhm stellte einen umgebauten Atari ST1040 aus. Gleich daneben hatte Stephan Sommer seine 8-Bit-Technik von Amstrad aufgebaut. Neben einem CPC 6128 und einem CPC 464 durfte eine Joyce selbstverständlich nicht fehlen.
Als guter alter CP/M-Computer reihte sich hier der Altos 580 von Helmut Jungkunz geradezu nahtlos ein. Schließlich hatte er in seinen besten Tagen reichlich mit CPC-Kollegen zu tun. Auf diesem Gerät lief nämlich die Z-System basierte Mailbox, die etlichen Usern noch als ZNODE 51 in Erinnerung sein dürfte. Nach dem Umzug der Mailbox auf einen anderen Computer landete der Altos bei Uli Staimer, der ihn aber bis dato kaum angerührt hatte. Diesem Umstand ist es zu verdanken, daß die originale ZNODE in all ihrer Pracht und Herrlichkeit auf dem VCFE bewundert werden konnte.
Wie nicht anders zu erwarten, durfte Helmuts CPU280 nebst einigen Videos und CDs von wichtigen 8-Bit-Events nicht fehlen. Und wie nicht anders zu erwarten, durfte auch Gaby Chaudry nebst einer eigenen Ausstellung nicht fehlen.
Diesmal hatte Gaby ausschließlich Geräte eines Herstellers mitgebracht. Scheinbar zufällig waren der HP 46, der HP 85B, der HP 2647A und der HP 9020 (9000 Series 520) der Größe bzw. dem Gewicht nach aufgereiht. Während man die beiden erstgenannten vielleicht als zu groß geratene Tischrechner registrierte, konnte kaum jemand der Verlockung widerstehen, wenigstens bei einem der wuchtigen Kolosse von Hewlett-Packard eine Taste zu drücken. Dies ist vor allem den Grafikfähigkeiten dieser Geräte zuzuschreiben. Aber auch die umfangreichen Dokumentationen, die Gaby mitgebracht hatte, luden zum Schmökern ein.
Mit dem SC/MP Development System und dem Intel SDK-85 von Hans Franke schloß sich schon fast der äußere Kreis. Ein Highlight fehlt aber noch: das BiTELEX von Bernhard Riedel. Dieses deutsch/arabische Terminal ist bemerkenswert. Mit Hilfe von zwei Videoeinheiten ist die gleichzeitige Darstellung lateinischer und arabischer Schriftzeichen auf dem Bildschirm möglich. Während man eine Nachricht verfaßt, kann jederzeit der Modus gewechselt werden. Dabei ändert sich beim Wechsel zu arabischen Schriftzeichen auch gleichzeitig die Schreibrichtung (von rechts nach links) und es werden automatisch Ligaturen gebildet. Das heißt, benachbarte Zeichen werden zu einem Schriftzug zusammengefaßt. Leider hat Bernhard keine Unterlagen zu dem Gerät, aber er hat bereits herausgefunden, daß ein modifiziertes CP/M als Betriebssystem dient.
Zahlreiche Homecomputer beanspruchten die innere Tischreihe; angefangen bei Michele Perini, der aus Italien angereist war und einen Olivetti M20 ST sowie zwei Alcatel ADF 258 ausstellte. Bernd Sedlmaier zeigte außer einem EPSON PX-8 die gesamte Palette der Atari Homecomputer: 400, 800, 600XL, 800XL, XE, 65XE. Nahtlos ging es mit einer ebenso vollständigen Reihe von Acorn weiter. Herbert Krammers Ausstellung beherbergte einen Acorn electron, einen Acorn BBC Master compact, einen Acorn BBC model B mit 6502 Zweitprozessor (sog. Tube) und einen Acorn BBC Master 128. Diese Geräte wurden seinerzeit speziell für den Bildungsbereich entwickelt. Darüber hinaus hatte Herbert aber auch einen Acorn RiscPC 600 sowie einen Archimedes 310 und einen Archimedes 420/1 mitgebracht.
Nebenan waren die Commodore-Fans aktiv, doch wie sich herausstellte, gehörte der VC-20 ebenfalls Herbert Krammer. Aber nun zur besagten Ecke mit dem allseits bekannten C=. Robert Sterff hatte nicht nur seinen C-64, sondern auch seinen Atari 130XE mitgebracht. Letztgenannter fristete - wie damals im wahren Leben - nur ein Schattendasein.
Als ungekrönter König im 10.000 m Lauf hatte Robert nämlich alle dazu aufgefordert, gegen ihn in dieser Joystick-Killer-Disziplin anzutreten. Also saßen am Sonntag stets zwei Leute vor Roberts C-64, die sich wie wild gebärdeten und fuchtelten, umringt von anderen, die das Geschehen am Bildschirm verfolgten und entsprechende Laute ausstießen. Letzten Endes mußten sich jedoch alle geschlagen geben und Robert blieb der ungekrönte König.
Heiko Irrgang hatte den Nachfolger des C-64, seinen C-128, gleich daneben plaziert. Arndt Oevermann konnte mit den großen Geschwistern auftrumpfen: Ein C-64 SX und ein C-128 D mit Festplatte zierten seinen Platz. Außerdem hatte er einen Philips MSX 2 dabei. Womit dann auch die Ausstellung komplett wäre.
Doch wie gehabt, war die Ausstellung längst nicht alles. Zahlreiche Besucher nutzten die bereits erwähnten Besichtigungstouren, um einmal einer Cray gegenüber zu stehen. Außerdem boten eine Reihe von Vorträgen ein reichhaltiges Programm für den interessierten Zuhörer.
Schon aufgrund meines Eintreffens am Samstagnachmittag sind mir einige Vorträge "durch die Lappen gegangen". So beispielsweise Helmuts Bestandsaufnahme zum Thema Z-System. Er hat mir die mehr als 200 Slides umfassende PowerPoint-Präsentation gezeigt. Erstaunt mußte ich feststellen, daß ich zwar irgendwie alles kannte, im Laufe der Zeit aber das eine oder andere Z-Tool in Vergessenheit geraten ist. Ähnlich ging es wohl auch den "alten Hasen" unter den Zuhörern, denn nicht nur die Neueinsteiger folgten dem fast eineinhalbstündigen Vortrag sehr aufmerksam, versicherte mir Helmut.
Der ungeteilten Aufmerksamkeit konnte sich auch Ray M. Holt gewiß sein. Er berichtete von einem Projekt, an dem er einst mitgewirkt hatte: Entwicklung und Produktion einer CPU, lange bevor Intels 4004 das Licht der Welt erblickte. Unter der URL
sind die vollständigen Informationen nachzulesen, von denen ich im folgenden nur einen Bruchteil wiedergeben möchte.
Ray wurde während seines Studiums unter anderem mit dem damals völlig neuen Wissensgebiet "logic design" konfrontiert. Allein das dabei erlangte Wissen war ausreichende Qualifikation, um von seinem damaligen Arbeitgeber engagiert zu werden, der seinerseits von der Air Force mit der Entwicklung eines Rechensystems für den F14 "TomCat" Kampfjets beauftragt worden war.
Die Arbeiten für das Projekt begannen im Juni 1968 und waren zwei Jahre später abgeschlossen. Am 21. Dezember 1970 startete erstmalig ein F14-Jet.
Hält man sich den technischen Entwicklungsstand zu Projektbeginn vor Augen, dann sind die erbrachten Leistungen umso bemerkenswerter. 1968 gab es noch keinen Prozessor, das Wort "Computer" war noch nicht einmal erfunden, lediglich die ersten Logikschaltkreise mit simplen Gattern begannen ihren Siegeszug.
Das Entwicklerteam sah sich vor eine schwere Aufgabe gestellt. Aus nur sehr wenigen per Sensorik ermittelten Daten mußten neben Flugdaten für andere Systeme vor allem Steuerungs- und Anzeigedaten für den Piloten berechnet werden. Was zunächst recht einfach klingt, ist in der Realität umso schwieriger. Unter Beachtung physikalischer Gesetze (und Grenzen!) sollten komplizierte mathematische Formeln zur Berechnung der Flugbahn in möglichst kurzer Zeit umgesetzt werden.
Bereits nach kurzer Zeit war die Entscheidung für eine völlig neue Technologie namens "LSI" gefallen. Es war klar, daß nur dieses hohe Maß an Integration (large scale of integration) die Anforderungen erfüllen konnte. Dieses hohe Maß an Integration bedeutete zu damaliger Zeit übrigens 100 bis 200 Transistoren pro Chip. Trotzdem bestand natürlich die Gefahr, daß man mit dieser sehr jungen Technologie auf das falsche Pferd gesetzt hatte, zumal eine Arbeitstemperatur von -55 bis +125 Grad Celsius zu gewährleisten war.
Ray hatte sowohl die originalen Schaltkreise als auch vergrößerte Kopien der Layouts mitgebracht, auf denen man beispielsweise die 20 Bit des A/D-Wandlers sehr gut erkennen konnte. Das Computersystem - es war halt nicht nur bei der CPU geblieben - arbeitete mit 19 Bits und einem Vorzeichen-Bit. Die CPU war mit 375 kHz getaktet und aufgrund der seriellen Übertragung zwischen den Flugzeugsystemen waren einige programmiertechnische Tricks notwendig, um innerhalb der zeitlichen Limits zu bleiben.
Wie bei jedem größeren Projekt, gab es aber auch einen herben Rückschlag. Eine Woche vor der Demonstration ist der Prototyp des Computersystems im wahrsten Sinne des Wortes abgeraucht. Nächtelange Arbeit war von einer Sekunde auf die nächste dahin. Letztendlich ist aber doch alles gut gegangen. Sämtliche Anforderungen wurden erfüllt oder übererfüllt und dem Jungfernflug stand nichts mehr im Wege.
Nachdem bereits etliche Jahre vergangen waren, bemühte sich Ray um die Rechte zur Veröffentlichung. Doch obwohl die technische Entwicklung erheblich fortgeschritten war, wurden die Informationen zu diesem Projekt noch immer als Militärgeheimnis betrachtet. Ray blieb aber hartnäckig und fragte im Abstand von ein paar Jahren immer wieder nach, bis er 1998 endlich die Genehmigung zur Veröffentlichung erhielt. Seitdem räumt er mit dem Irrtum auf, Intel habe die erste CPU entwickelt...
Den Abschluß des VCFE bildete die Bekanntgabe der "offiziellen Zahlen" und die Vergabe des Besucherpreises. Demnach drängten sich 180 zahlende Besucher durch die Halle, die bereits von 30 Ausstellern (inoffiziell wohl eher 40) gut gefüllt war. Mit 13 Stimmen errang die PDP 8 Ausstellung von Herrn Schünemann den ersten Platz und damit den Besucherpreis.
Getreu dem Motto "Nach dem Festival ist vor dem Festival." gibt es auch schon Pläne für das nächste Jahr. Am besten, Ihr schaut es Euch selbst an!
Das CPC-Klassentreffen 2001 in Erlangen
von Ralf Däubner
1.Tag -- Die Ankunft in Erlangen:
Also, um es ganz kurz zu machen, zu erst hieß es, etwa 200 Kilometer mit 140 - 160 auf dem deutschen Autobahnnetz zu bewältigen. Für Statistiker: etwa 100 km auf der A9; 60 km auf der A70 und 40 km auf der A71 bis Erlangen. Der Wettergott meinte es richtig gut mit den Bauern und Kleingärtnern, aber nicht mit den Autofahrern.
Als ich ankam, war niemand da - vorerst. Die Franzosen hatten schon ihre Maschinen aufgebaut. Immerhin kamen nach 10 min die Organisatoren des Treffens. Somit konnte ich für meinen kleinen KC einige Träger verpflichten. Nach und nach füllte sich der Raum. Daß mein KC natürlich angesichts der Masse diverse Fragen auslöste, war nicht verwunderlich.
Inzwischen wurde es voller und so gegen Abend kam eine richtige Party-Stimmung auf. Leider mußte ich wegen der Übernachtung schon gegen 6 Uhr aufbrechen.
2. Tag:
So gegen 8 Uhr trudelte ich am konspirativen Treffpunkt ein. Das dumme war nur, daß noch einige gemütlich schliefen. Wenig später erschien dann Thomas Rademacher und präsentierte ein Bild, was ich Euch nicht vorenthalten möchte. Nun gab es ein kleines Problem: Wie bekomme ich den Screen des CPC auf den KC? Mr. AMC und Thomas machten sich gemeinsam an die Arbeit. Herausgekommen sind zwei BASIC-Programme, einmal für dem cpc (kc-compact) und einmal für dem KC85. Leider konnte ich nicht viel zum KC-BASIC beitragen. Zum meinem Glück hatte ich wenigstens die wichtigsten Hefte des KCs mit.
Die Franzosen präsentierten die neusten Demos auf ihren Plus-Modellen. Immer wieder wurde ich gefragt, was das eigentlich ist und ob die übereinandergestapelten Kisten mehrere Computer sind.
Inzwischen wurde es immer später und voller. Das tat der Stimmung aber keinen Abbruch, im Gegenteil, es wurde immer besser. Diverse Groups bauten ihre Anlagen auf. Zum Teil wurde gezockt und geschaut. Von überall her hörte man den typischen CPC-Sound, genauer gesagt den des AY-Sound-ICs. Ich für meinen Teil spielte die altbekannten Shows ab. Erstaunen rief die Tatsache hervor, daß beim KC nur Bilder verschoben werden. Die Franzosen staunten gerade bei der Kugel-Show nicht schlecht.
Und wie immer hieß es 'rumstöbern und fragen. So konnte man auch den Programmierern über die Schulter schauen.
15 Stück 6128, 7 Stück 6128 plus, 6 IBM-Kompatible und 1 KC85/5 in den unterschiedlichsten Ausbaustufen waren zu besichtigen. Leider war kein KC-compact zu sehen! Unter anderem waren auch einige Exoten mit unaussprechlichen Namen zu sehen.
Einigen nicht ganz unwichtigen Leuten der Szene präsentierte ich das ultimative ZDF-Video, nachdem es mir gelungen war, einen PC zu erobern. Die CD, die Jörg Linder erstellt hat, ist sehr gut für solche Zwecke einzusetzen. Sie waren sehr erstaunt, daß es für den KC eine richtige lebendige Szene gibt. Dank der hervorragenden Shows von Ralf Kästner und Mario Leubner (und natürlich den zugehörigen Programmen) war das Erläutern des KCs ein Kinderspiel. Für die Franzosen völlig neu war das Einfügen von Grafiken in Textdokumente.
Die Wizcat's stellten ein einfaches CPC-Netzwerk vor. Einfacher geht es im dem Falle überhaupt nicht mehr, sie nutzten einfach 4 Daten-Bits des Druckerports. Die Z80-PIO kann schon von Haus aus voll Duplex arbeiten.
3. Tag:
Sonntags früh wie immer: Alle pennen noch. Ich habe etwas Zeit, diesem Bericht zu schreiben. Nach und nach kamen doch noch alle aus ihren Federn gekrochen. Leiter mußte ich gegen 13 Uhr den beschwerlichen Heimweg Richtung Gera antreten. Zuvor habe ich Mark MC Ready den Begriff COMPUTERSPORT auf anschauliche Art erklärt. Ich hoffe, er hat sich nicht verhoben (mein KC bringt so an die 30 Kilo auf die Waage).
Ein besonderer Dank gilt den Organisatoren des Treffens. Für Essen und Trinken war reichlich gesorgt.
CAOS-(Start)Diskette mit DEP 3.0 ?
von Mario Leubner
Bisher war DEP 3.0 nur denjenigen vergönnt, die eine Festplatte in Ihren KC eingebaut haben und somit das neue ML-DOS im Hintergrund laufen hatten. Mit der Freigabe von ZSDOS können jetzt auch alle "Nur-Disketten-Nutzer" sich eine Startdiskette erzeugen, die mit DEP 3.0 arbeitet.
Was braucht man dazu? Eine Diskette und die folgenden Programme:
- SYSGEN.COM (aktuelle Version ist 1.2)
- CAOS.SYS (System ML-DOS für CAOS)
- DEP3.COM (Diskettenerweiterungsprogramm)
Das Geheimnis steckt in der Datei CAOS.SYS. Diese enthält ein komplettes ML-DOS, also einen Systemabzug einschließlich ZBIOS und ZSDOS, allerdings nur mit den Diskettenlaufwerken wie bisher unter DEP 2.2. Wer sich seine CAOS.SYS selbst erzeugen will, der lese bei den entsprechenden Stellen zum System ML-DOS nach. Wer meine CAOS.SYS verwendet, der hat folgende Laufwerke zur Verfügung:
- A: RAM-Floppy im TPA (45k)
- B: phys. LW 0, 780k (Standard-Laufwerk)
- C: phys. LW 0, 624k
- D: phys. LW 0, 800k
- E: phys. LW 1, 720k
- F: phys. LW 1, 780k
- G: phys. LW 1, 708k
- H: phys. LW 2, 780k
Im Hintergrund werkelt dabei ZDDOS, man könnte also sogar die Datumseinträge verwenden. Voraussetzung ist dazu natürlich die Eingabe des Systemdatums und der Uhrzeit bei jedem JUMP FC. Wie das geht, zeige ich gleich.
Starten wir also zunächst eine CP/M-Betriebsart-Diskette, z.B. MicroDOS. Auf einer Diskette (oder im RAM-Floppy) sollten sich die Dateien SYSGEN.COM und CAOS.SYS befinden. Außerdem sollten wir DEP3.COM bereit halten. Wir wechseln zu dem Laufwerk, wo sich SYSGEN.COM befindet und starten es. Unter Menüpunkt 1 wählen wir die Datei CAOS.SYS aus. Weiter ist nichts erforderlich; die anderen Treiber sind nur für die PC-Betriebsart von Bedeutung und interessieren uns hier nicht. Einziger wichtiger Punkt ist 6. Start-SUBMIT. Dieser soll in unserem Fall dafür sorgen, daß die CAOS-Betriebsart mit DEP3.0 gestartet wird. Wir geben ein:
A0>B:;DEP3 INITIAL.UUU
Nun kann Menüpunkt 7 - Beschreiben der Systemdiskette - aufgerufen werden. Eventuell sollte an dieser Stelle die richtige Diskette eingelegt werden! Nach Angabe des Laufwerkes werden die Daten in die Systemspur geschrieben.
Nun ist die neue CAOS-Startdiskette fast fertig. Wir müssen nur noch die Datei DEP3.COM darauf kopieren, das war dann schon alles. Jetzt können wir die soeben erstellte Diskette mit JUMP FC testen. Zunächst wird die PC-Betriebsart gestartet, der Start-SUBMIT wechselt automatisch von Laufwerk A: nach B: und führt dort die Datei DEP3.COM aus. Dieses DEP3 startet die CAOS-Betriebsart. In dem Kommando haben wir als Parameter INITIAL.UUU angegeben: Das bewirkt das automatische Abarbeiten einer solchen Datei, so wie bei DEP2 auch. Nun können wir im CAOS ganz normal arbeiten, einschließlich des Kommandos DRIVE!
Ach ja, wer die Uhr des DEP 3.0 verwenden will, der sollte seine Diskette mit PUTDS.COM für Datumsstempel vorbereiten. Und damit die CTC-gesteuerte Uhr richtig geht, muß das Start-SUBMIT wie folgt erweitert werden:
A0;T S;B:;DEP3 INITIAL.UUU
Das war schon alles. Bei jedem Systemstart muß man jetzt aber Datum und Uhrzeit eingeben, was das CCP-Kommando T S am Anfang bewirkt.
CAOS-Dateien unter CP/M erzeugen
von Mario Leubner
Enrico Grämer fragte mich neulich:
- "Wenn ich mich richtig entsinne, stand in dem Assemblerkurs nix darüber, wie ich unter CP/M ein CAOS-Programm schreibe. Kannst Du mir mal 'nen Tip dazu geben, z.B. wie das am Besten mit dem Vorspann zu lösen ist?"
Das geht ganz einfach: Der Vorblock ist 128 Bytes groß und wird mittels DEFB-Anweisungen gefüllt. Danach kommt der CAOS-Programmcode. Um die Adressen im CAOS-Vorblock automatisch zu setzen, schreibt man entsprechende Marken ins Programm und legt diese mit Hilfe von DEFW-Anweisungen im Vorspann ab. Das Ganze sieht dann etwa so aus:
; CAOS-Vorblock:
DB '12345678ABC' ; Dateiname 12345678.ABC (kompatibel zum
; Kassettenformat, kann auch entfallen)
DS 5,0 ; 5 Byte frei
DB 3 ; 2 falls ohne, 3 falls mit Startadresse
DEFW AADR ; Anfangsadresse
DEFW EADR ; Endadresse + 1
DEFW SADR ; Startadresse
DS 105,0 ; der Rest im Vorblock ist frei!
; Programmcode:
ORG <adresse> ; CAOS-Adresse festlegen
AADR:
<programmcode>
SADR:
<programmcode>
EADR:
END
Die Marken AADR, EADR und SADR setzt man an die gewünschten Stellen und während der Assemblierung werden die Marken belegt.
Die genaue Syntax ist noch etwas abhängig je nach verwendetem Assembler, aber das Prinzip dürfte erkennbar sein. So macht sich beim ASM.COM von "robotron" statt der ORG-Anweisung ein .PHASE gut, um die KC-Adresse einzustellen. Man muß nur aufpassen, daß der Assembler bzw. Linker die Datei so erzeugt, daß nicht vor der CAOS-Adresse noch entsprechend viele Dummy-Bytes stehen.
Ein Beispiel dieser Art findet Ihr z.B. in meinem Quelltext WPLOAD6.Z80 (im Archiv von WordPro6). Also dann viel Erfolg damit!
BASIC- und andere Experimente
von Ralf Däubner
Hier ist nun das Bild und die zugehörigen, bei der Konvertierung entstandenen kleinen BASIC-Programme für den CPC 6128 und KC85 (siehe dazu auch den Bericht vom CPC-Treffen). Das Bild stammt vom C+4-Userclub.
Programm BIKER.SSS für den KC85 (Datensatz KONBIKE.UUU):
100 CLS:OPENI#1"KONBIKE"
110 FOR Y=0 TO 199
120 FOR X=0 TO 319
130 LOCATE 27,27:INPUT#1 P$
150 IF P$="a" THEN PSET X,Y,7
160 NEXT
170 NEXT
180 CLOSEI#1
190 LOCATE 27,27:PRINT" "
Im Gegensatz dazu nun das Programm AMS.SSS für den CPC (Datensatz KONDINGS.UUU):
100 OPENI#1"KONDINGS"
110 FOR Y=0 TO 199
120 FOR X=0 TO 319
130 INPUT#1,P1:INPUT#1,P2
150 PSET X,Y,P1*7
160 NEXT
170 NEXT
180 CLOSEI#1
Von der Festplatte dauert es nicht allzu lange, um das Bild aufzubauen. PICGEN habe ich für den Screensave genutzt. Es gehört zum Lieferumfang von WordPro6. Damit Ihr es nicht suchen müßt, habe ich es mit ins Archiv aufgenommen.
Als Zugabe gibt es hier noch zwei kleine BASIC-Programme.
Programm SWITCH.SSS:
10 FORX=16 TO 40 STEP 4
20 SWITCHX,1:PAUSE5:SWITCHX,0
30 NEXT
Programm DIO3.SSS:
1 REM EINSCHALTEN DES MODULS AUF SCHACHT 2CH (44)
2 REM INITIALISIEREN DER PIO-PORTS A UND B AUF BITBETRIEB
10 CLS:SWITCH44,1:PRINT"DIO IM SCHACHT 2C AN"
20 OUT 6,207:OUT6,0:OUT7,207:OUT7,0
30 PRINT"BITBETRIEB EINSCHALTEN"
40 FORX=0TO255
50 OUT4,X:OUT5,X:PRINTAT(8,9);X
60 NEXT
70 OUT4,0:OUT5,0:SWITCH44,0:PRINT"ALLES AUSSCHALTEN"
SWITCH.SSS schaltet alle Module von Aufsatz 1 und 2 durch und DIO3.SSS schaltet ein M001 aktiv. Dabei wird eine einfache FOR-NEXT-Schleife durchlaufen. Die eigentliche Ausgabe erfolgt an den PIO-Ports A und B des Moduls. Ich habe 16 LEDs direkt an die Portleitungen angeschlossen, was eine einfache "Lichtorgel" ergibt. Damit kann man sich mit dem Problem der Ansteuerung einer PIO beschäftigen. So nebenbei kann man einfache Programme zur Ansteuerung eines einfachen Soundmoduls mit dem 555 schreiben.
Schaut Euch bitte erst die Listings an, bevor Ihr die Programme startet! Ich habe in dem Bereich nichts, was kaputtgehen könnte.
Abschließend möchte ich Euch ein paar Hardware-Bastelein zum Thema Sound vorstellen. Diesmal benutzen wir nicht den BASIC-Befehl SOUND, sondern einfach eine PIO (M001). Genaugenommen wird es beim KC intern auch nicht anders gemacht, nur mit dem Unterschied, das hier ein B555 (NE 555) zum Einsatz kommen soll. Des weiteren natürlich ein kleiner Frequenzteiler, um wenigstens 3 Oktaven zu erhalten. Ich weiß, der KC kann mehr, aber wie! Die erste Schaltung ist direkt von einer 7-Ton-Klingel übernommen und die zweite Schaltung ist die Grundschaltung für den Tongenerator. Außerdem gibt es auch den Frequenzteiler zu sehen.
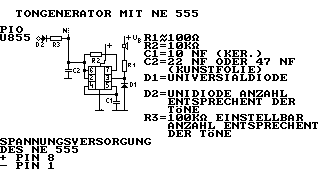
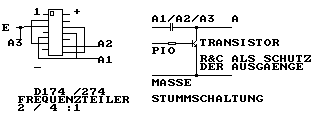
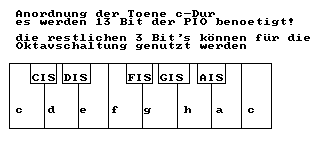
Bild 1: Gedanken zur PIO-gesteuerten Sounderzeugung.
Damit läßt sich sicher schon viel anstellen. Wer's übertreiben möchte, baut sich für jeden Ton einen Tongenerator. Aber Achtung, es müßen noch 3 Bits zur Steuerung der Oktaven frei sein! Dafür kann er dann im gewissen Sinne Polyfon.
Eine andere interessante Sache stellt die leider in Englisch gehaltene Hardware-Dokumentation zu einem Mod-Player dar. Daß dieser Mod-Player schon mit einem 286-er PC mit Speaker funktioniert, tut nichts zur Sache. Jedenfalls wird auch hier eine PIO benutzt. Vielleicht übersetzt die mal jemand. Leider kann man sie zur Zeit nur mit einem richtigen DOS ausdrucken. Die Software ist vom Prinzip her nichts weiter als eine PIO-Ansteuerung. Die kann über CAOS wie auch über BASIC realisiert werden.
Da war noch was! Ach ja, beim CPC gab es einen Digiblaster - was auch immer das sein mag. Dieser wurde ebenfalls über den Parallelport angesteuert.
Und nun mal noch eine andere nicht ganz unwesentliche Frage: Was ist eigentlich aus dem Soundmodul geworden?
Weltzeit: ... und noch ein kleines BASIC-Programm
von Reinhard Gitter
Zur Zeit ist der Empfang von Videotext mit dem KC leider noch nicht möglich. Ich habe zwar die Software für den KC 85/3, aber keinen Schaltplan für den Decoder. Deshalb habe ich schon mal die ARD-Weltzeituhr (Videotext-Seite 599) auf dem KC zum ticken gebracht.
Nach dem Start des Programms ist die Stadt auszuwählen, von der man die genaue Uhrzeit kennt (für Berlin reicht auch <Enter>). Nun wartet der KC noch auf die Eingabe der Uhrzeit und die Angabe, ob bei uns gerade Sommer- oder Winterzeit herrscht. Mit der Aufforderung <Enter> wird die Uhr gestartet. Die Zeit für den Bildaufbau wird vom Programm berücksichtigt und die Uhr entsprechend vorgestellt. Jede volle Minute wird nun, wie es auch beim Original auch sein sollte, das Bild aktualisiert. Oben rechts wird zusätzlich die Zeit für Berlin angezeigt.
In der untersten Zeile steht entweder WINTERZEIT oder SOMMERZEIT. In diese kann man durch die Eingabe von <W> oder <S> wechseln. Die Uhrzeit für Berlin läuft dabei weiter, die Zeiten für alle anderen Städte werden neu berechnet. Diese Funktion wird ca. 10 Sekunden vor der vollen Minute gesperrt und ausgeblendet, da der Bildschirmaufbau zur vollen Minute abgeschlossen sein muß. Fast jederzeit ist dagegen eine Neueingabe der Anfangsstadt und der Uhrzeit mit <N> möglich. Mit <E> kann das Programm beendet werden.
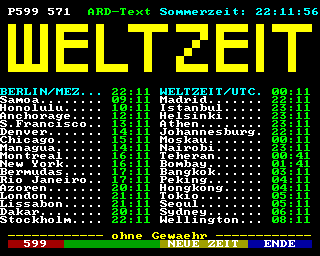
Die Berechnung der Uhrzeit erfolgte nur nach Angaben der ARD-Weltzeituhr im Zeitraum Januar bis April 2001! Differenzen bei der uneinheitlichen Sommer- und Winterzeitumstellung der einzelnen Länder können leider nicht berücksichtigt werden. Eventuell folgen in zukünftigen KC-News berichtigte Versionen.
Für die Zukunft suche ich weitere sinnvolle Videotextseiten, die ich dann für den KC umschreiben würde. Auch die jetzt überall im Fernsehen auftauchenden Quizshows wie z.B. "Wer wird Millionär?" usw. würden sich prinzipiell (mit einfacherer Grafik) auch für den KC umschreiben lassen. Aber wer hat schon die vielen Fragen und Antworten gesammelt, und auch noch Zeit und Lust die große Datenmenge einzutippen? Wenn jemand Vorschläge haben sollte, kann er sich ja bei mir melden.
Da ich gerade beim Schreiben bin, möchte ich zu Schluß noch auf die Internetseite eines Bekannten von mir hinweisen. Ronald Görlich aus Großpostwitz hat sich ein kleines Computermuseum unter
eingerichtet und würde sich über interessierte Besucher freuen.
Zeitreise -- ein rein theoretisches Experiment
von Elmar Klinder und Henning Räder
Das Programm ZEITREIS.SSS hat mir Henning Räder als ZX-Listing geschickt. Da sein KC nicht lief, habe ich es für den KC eingegeben. Zusätzlich habe ich mir aus GAM.SSS einige Zeilen geborgt und ZEITREIS.SSS damit "verschönert". Es handelt sich um ein Programm zur Simulation von Reisen mit Lichtgeschwindigkeit. Es sind aber leider nur bis zu 99 Prozent Lichtgeschwindigkeit eingebbar.
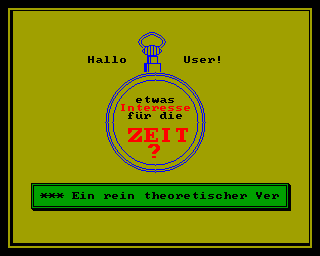
In Weiterführung des Programms "Zeitreise" möchte ich noch ein paar zusätzliche Informationen beisteuern. Auf 3-Sat habe ich in der Sendung hitec - Thema Zeitreise den Namen eines Professors erfahren, der an einem Doppelprisma 8-fache Lichtgeschwindigkeit realisiert hat. Es ist Prof. Nimtz vom 2. Physikalischen Institut der Uni Köln. Ich habe ihm geschrieben und in seiner Antwort teilt er mir folgendes mit: "Das Tunneln steht außerhalb der Relativitätstheorie. Am Eintritt des Tunnels geht eine Zeit verloren (ca. die Schwingungszeit der Welle), während im Tunnel selbst keine Zeit verloren geht. So ist deshalb die Tunnelgeschwindigkeit abhängig von der Tunnellänge, sie wächst mit der Tunnellänge x. Dabei nimmt allerdings auch die Intensität exponentiell ab, v=x/t z.B. 0.3 m / 100 ps = 10c (zehnfache Lichtgeschwindigkeit). t ist die genannte Tunnelzeit am Eingang."
Es geht hier um die Frage, was passiert, wenn wir sogar größere Geschwindigkeiten als Lichtgeschwindigkeit realisieren. Prof. Nimtz hat das vorerst nur mit Hilfe eines Signals erreicht - soviel ich weiß aber erstmalig. Im Internet unter
wird Prof. Nimtz wie folgt zitiert: "Die derzeitigen Ergebnisse zeigen ausschließlich, daß wie etwas früher erkennen können, daß wir also ein wenig in die Vergangenheit zurück können. Aber es reicht nicht aus, um die Vergangenheit zu verändern."
Spielekatalogisierung: Neue UNIPIC-Shows
von Elmar Klinder
Es fing harmlos an mit ca. 15 Disketten voller Spiele, die ich mit der Floppy bekam. Alles mal geladen und probiert. Ergebnis: ein Sammelsurium an Spielen, vieles doppelt, einiges defekt oder auf dem 5-er nicht lauffähig. Natürlich auch nicht in der Ordnung, die ich bevorzuge. Also Sortieren, und wie das so ist, man schiebt's vor sich her.
Dann gab's auch noch das Umrüsten zum 5-er, Festplatte usw. Inzwischen kam ich mit UNIPIC ganz gut zurecht und auf die Idee, meinen Bestand an Spielen als Bilder zu sortieren, oder zumindest eine Art Übersicht zu machen. Also angefangen mit PICGEN. Dann brachte Mario SCREEN heraus und das ging besser. Da ich jedes Spiel mit Titelbild, Beschreibung, Spielbild usw. screente, wurden daraus 25 Disketten. Und eigentlich wollte ich nur eine DSH machen... Jetzt sind es 7 mit ca. 267 Bildern! Da ich keinen PC besitze, habe ich die PCX-Variante links liegen lassen. Zudem waren ja schon einige Bilder mit PICGEN gemacht.
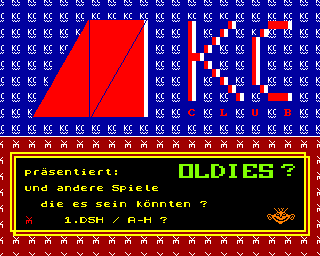
SP-DSH05.DSH enthält die Copyrights, die in den Bildern auftauchen und SP-DSH06.DSH enthält die Figuren und "Bauteile" der Spiele. Zumindest einige davon.
Da einige Spiele unter verschiedenen Namen im Umlauf sind, wäre es eventuell eine Hilfe. Ich habe z.B. für die Bilder den Namen verwendet, unter dem das Spiel auf meinen Disketten war. Und das stimmt in einigen Fällen wohl nicht (Xonix als Oni usw.). Des weiteren ist da noch ein Filmuster dabei, sowie FRASTER(1 + 2).PIP, das ich mir mal gemacht habe, um zu sehen, wie mein Drucker Schwarz auf Gelb usw. bringt (siehe EKLINDER.PMA).

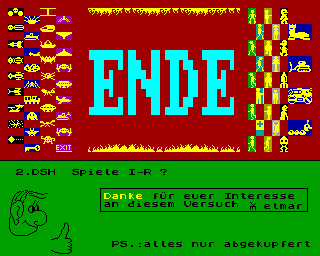
Hardware-News
von Guido Speer und Enrico Grämer
Festplatteninterface (GIDE) wieder verfügbar - zumindest bald
Seit dem Clubtreffen in Pechtelsgrün habe ich "irgendwie" die Koordinierung für die Festplatteninterfaces übernommen. Nachdem die letzte von Tilmann Reh bezogene Serie Platinen und GALs alle war, war auch kein Bedarf mehr da. Aber wie das so ist, irgendwann wollte doch jemand noch einen Bausatz haben. Wegen einem (oder 2 - 3) war natürlich nichts mit Tilmann zu machen. Ist ja auch verständlich. Ich wollte also Bestellungen sammeln und dann ... ja dann kamen keine Bestellungen mehr. Die Monate rauschten durch und plötzlich: 2 Bestellungen! Ich habe bei Tilmann nachgefragt und er sagte die weitere "Produktion" aus Zeitgründen ab. Schöne Pleite!
So, das war die schlechte Nachricht, jetzt die gute: Tilmann hat für den Club den Code für die Gals freigegeben (solange nichts kommerziell genutzt wird), was im Klartext heißt, ich habe die nötigen Dateien. Enrico Grämer ist seit 3 - 4 Wochen dabei, die Platinen neu zu entwerfen. Bei der Gelegenheit werden natürlich alle Erfahrungen, die wir mit den GIDE gemacht haben, berücksichtigt. Naja, zumindest einige. Es kommt u.a. die Reset-Schaltung mit dem 7705 sowie ein Extraanschluß für Notebookplatten (44-polig) mit drauf. Nach einiger Diskussion haben wir es sogar geschafft, die Batterie für den RTC-Chip mit auf die Platine zu bekommen.
Was wird das Ganze kosten? Im Moment: Keine Ahnung! Wahrscheinlich wird es irgendwo in der Nähe der alten Bausätze liegen, also ca. 90,-- DM + X (X = abhängig von den Platinenkosten bei PCB-Pool) Hieraus ist zu sehen, je mehr Bestellungen um so besser bzw. billiger wird es. Darum eine Bitte: Diejenigen die per Mail, Post, Telefon oder sonst wie bei mir schon nach dem alten Bausatz gefragt hatten, sollen sich noch ein mal melden; möglichst per Mail (notfalls per Post) und möglichst nicht per Telefon (kann man so schlecht abheften ;-)) und eine verbindliche Bestellung abgeben. Wenn mindestens 10 Stück zusammen kommen, geht das Ganze bei PCB-Pool (oder einer anderen Firma) in die erste Runde. Ausgeliefert wird sofort, wenn die Platinen da sind. Ich darf mir vorher noch einen GAL-Programmer bauen (Galblast von MaWin, das wollte ich sowieso) und zusehen, daß dann die verwendeten GALs (von Tilmann vorgegebene Typen) nicht schon wieder "out" sind.
Also, schon mal auf Flohmärkten oder bei eBay Notebook-Platten hamstern und abwarten.
Tastatur-Interface und Scanner-Modul M051 -- Neue Serien
Für die zweiten Serien von Tastatur-Interface und Scanner-Modul M051 können noch immer Bestellungen abgegeben werden. Es wird allerdings keine Fertiggeräte, sondern nur noch Bausätze geben. Zum Zusammenlöten habe ich einfach nicht mehr die Zeit. Aber vielleicht kann das ja jemand anders übernehmen.
Die Preise der Bausätze sind von den jeweils aktuellen Bauteilpreisen und der Stückzahl (insbesondere für die Leiterplattenherstellung) abhängig. Als grobe Schätzung kann man für das Tastatur-Interface von 30 - 40 DM ausgehen. Das M051 wird bei der Bestellung von mindestens 10 Stück ca. 150 - 160 DM kosten, ohne Controller etwa 10 - 15 DM weniger.
Beim M051 sind die nachträglich bei der ersten Serie aufgetretenen Änderungen bereits mit berücksichtigt. Das Bild zeigt noch einmal die Veränderungen, die so auch für die erste Serie gelten (RESET-Beschaltung des Controllers und Ersatz der Widerstände R19 und R21 durch Brücken).
- plan.eps ... Auszug aus dem Schaltbild des Scanner-Moduls
Die Computerfreaks
Oft werden die Computerleute verkannt. Laien halten sie für automatenhaft funktionierende unheimliche Kopfarbeiter, die keiner richtigen Gefühlsregung mehr fähig sind. Fachkollegen bezeichnen sie als Hacker, die mangels Kontaktfähigkeiten zu Menschen mit dem Sklaven Computer vorlieb nehmen - Tag und Nacht.
"Unermeßlich vielfältig sind die Arten der Erdenwesen. Daraus aber ragt der Mensch hervor, der die Sprache erfunden hat, die so vielfältig ist, daß man keine zwei findet, welche ein und die selbe sprechen." Prof.Ungrün
Hier soll von den liebeswürdigen Lebewesen berichtet werden, die sich "Computerfreaks" nennen, wie sie leben und welche eigenartigen Sitten und Gebräuche sie haben.
Wer von den Computerfreaks kein eigenes System laufen hat, wer nicht tief in der Hardware wühlt, gilt bei Ihnen wenig. Sie werden beherrscht von dem Gedanken, jedes technische Problem lösen zu können, und das mit Leichtigkeit und in kurzer Zeit. (Ein System ist alles, was keines hat, Hardware das, was beim Runterfallen klappert, und Software das, wovon man logisch erklären kann, warum es nicht funktioniert. Nicht zu verwechseln mit dem Problem, herauszufinden, warum man sie nicht zu Funktionieren bringt. Diese Frage ist ungelöst.)
Sie sammeln (meist abgekupferte, ein Ausdruck, der hier nicht näher erläutert werden soll) Software, aber meistens bedeutet ihnen die "höhere Software" eigentlich wenig. Ihre Domäne sind die Bits und Bytes, die Controller und schnellen RAMs. In der Regel sind sie Einzelkämpfer, wiewohl sie auf eine gewisse geheimbündlerische Art zusammenhalten. (Bits und Bytes sind das, was zwischen Hard- und Software steht, Controller und RAMs unterscheiden sich nicht: schwarze Käfer mit einer Anzahl in Doppelreihe angeordneter, spitzer Drahtfüßchen.)
So leben sie
Manchmal hegen sie puritanische Neigungen, zum Beispiel hinsichtlich höchstqualitativer Disketten, deren Label (Etikett) sie, wenn überhaupt, nur mit zart jungfräulicher Bleistiftschrift entweihen. Disketten sind schwarze Scheiben, auf denen angeblich etwas in magnetischer Schrift geschrieben ist, was aber unsichtbar und aus unbekannten Gründen auch mit dem Computer nicht zu lesen ist. Wenn man sie knickt, auf Magnete oder in die Sonne legt, wird man ohne Kommentar umgebracht.
Die Beziehung der Computerfreaks zum anderen Geschlecht wirft einige Fragen auf. Vergleichbares gibt es höchstens bei HiFi-Enthusiasten, die um größere Boxen kämpfen und das Recht sie nicht hinter dem Vorhang verstecken zu müssen. Doch ist es anders. Sie breiten ungehindert ihre Platinen und ICs in der Wohnung aus, weiß der Teufel, warum Eva das zuläßt. Verstehen tut sie nichts davon - vielleicht aber gerade deshalb. Frauen versuchen nur das zu verhindern, was sie verstehen. Jedenfalls sind Leute, die solche Annoncen aufgeben: "Wegen Heirat Computersystem zu verkaufen", keine ganzen Männer.
Wenn Computerfreaks zusammen kommen, dann nicht ohne meterlange, gefaltete Listings. (Das sind Papierfahnen, die von einem ratternden Drucker oder einer elektronischen Schreibmaschine ausgespien werden. Das ist übrigens der Grund, warum der Rest der Familie nachts nicht schlafen kann und diese dunkle Ringe unter den Augen hat.) Meistens bringen sie sich irgendwelche Platinen mit und diskutieren über Schaltkreise und Packungsdichte. Das ist sehr wesentlich, weil der Computer daraus besteht. Dabei wechseln innerhalb eines Clubs oder Stammtisches die Standards - früher fachsimpelte man über Kassetteninterfaces (die so schrill zirpten wie eine Grille, die die Schallmauer durchbricht), dann über kleine, später über große Diskettenlaufwerke.
Das Eheleben der Computerfreaks
In alle Projekte der Computerfreaks wird die Ehefrau immer mit einbezogen. Dabei ist das erste Problem der Kampf um den Standort des Computers. "Nur ein kleines Eckchen" gehört zum anfänglichen Standardvokabular der Überzeugungstätigkeit. (Die Frau hat noch keine Ahnung, was da auf sie zukommt .) Das zweite Problem der Überzeugungsarbeit ist das Suchen nach Argumenten sinnvoller Anwendungen im Heim und Garten, um so die notwendigen Mittel aus dem Haushaltsplan freizubekommen und zu begründen. Dabei wird die Erfindungsgabe und der Phantasiereichtum des Computerfreaks stark beansprucht. Drittens sind die zeitlichen Bilanzanteile zu sichern und im Familienleben auszuplanen.
Der Computerfreak ist ständig bemüht, die Ehefrau an seinem Glück teilhaben zu lassen. Kaum klappt etwas oder auch, nicht, wird etwas Neues geschrieben und es läuft erwartunsgemäß nicht, wird sie vom Kochtopf gezerrt, muß Putzeimer und Wischlappen fallen lassen, wird aus dem Bett geworfen, muß ihre Lektüre zur Seite legen, kurz: Zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit wird sie vor das Ding geschleppt. Aber damit nicht genug. Sie muß auch noch sachkundig ihre Meinung dazu äußern. Tut sie das nicht, oder kommt gar mit der "Ausrede" das wären alles böhmische Dörfer und das verstehe sie nicht, wird ihr lang und ausführlich erklärt, was gerade läuft, warum es läuft, welche Verknüpfungen und Sprünge, welche Adressen und Programme dazu notwendig waren.
Aber sie begreift natürlich nichts. Das einzige was sie wahrnimmt, sind irgendwelche Hieroglypen, die auf dem Bildschirm rumflitzen. Auf die Frage: "Hast du alles verstanden ?" nickt sie ergeben. (Bloß nicht den Kopf schütteln, sonst geht das ganze von vorne los und meist noch mehr ins Detail.) Die gröberen Hardware-Arbeiten werden in der Küche durchgeführt. Da ist so richtig Platz für die Fachunterlagen, Schaltpläne, Lötkolben und Lötzinn. Zum Essen schiebt man den ganzen Kram mit beiden Händen sanft und vorsichtig nach hinten, zur Seite oder sonstwohin, damit man gerade ein kleines Plätzchen für den Teller hat.
Im übrigen gehen bei solchen schnöden Maßnahmen wie Essen und Schlafen wertvolle Rechenzeit verloren, so daß diese Dinge auf das absolute Mindestmaß reduziert werden müssen.
Das sind ihre Sprachen
Bei den Programmiersprachen gibt es Modeströmungen, die ungefähr mit den Jahreszeiten wechseln. Man bevorzugt Esoterisches wie "C" oder "Lisp" bzw. Handfestes (FORTRAN, COBOL), aber eigentlich gibt es für jede Sprache jemanden, der alles übrige als Quatsch abtut. Und natürlich PASCAL - denn wie sonst soll sich der kultivierte Computerfreak von der Masse derer abheben, die mit Mühe gerade mal eine FOR-NEXT-Schleife ohne Verschachtelungskollision zustande bringen.
Bisweilen kommt es vor, daß sie über geheimnisvolle Dinge in Gelächter ausbrechen (nicht mitlachen ist ein Zeichen mangelnder Intelligenz), z.B. über einige Assembler-Statements oder die Schaltung eines Datenseparators. Ihre Zunft scheint eine neue Art Komik zu kreieren, so ist ihr Gebiet alles andere als trocken, es lebt. Software und Systeme, die nicht laufen wollen, sind eine spannendere Herausforderung als jedes Abenteuer.
Das treibt sie an
Typischerweise werden große Projekte ins Auge gefaßt, die nie realisiert werden. Dennoch gibt es einen eindeutigen und überraschenden Fortschritt, denn diese Projekte bauen ja auf den früheren auf. Man kann das nicht verstehen, wenn man nicht einsieht, daß in der Computerei vor allem der abstrakte Entwurf zählt. Die Philosophie der Computerfreaks ist in gewisser Weise durch Prof.Ungrüns Satz zu charakterisieren: "Nichts ist langweiliger als ein Programm, das endlich fehlerfrei läuft". Das muß wohl auch auf die Hardware zutreffen. Sie haben ein großes Talent, diesen traurigen Zustand nie eintreten zu lassen, aber sie glauben, daß sie permanent mit aller Kraft versuchen, diese Situation zu überwinden.
Sie unterhalten sich in einer Weise, daß ein gewöhnlicher Sterblicher bei jedem zweiten Wort nicht weiß, wo er nachschlagen könnte - es ist auch nicht sicher, daß sie sich gegenseitig verstehen. Wenn sich drei unterhalten, kann mindestens einer nicht ganz folgen, weil er sich mit einem anderen Spezialgebiet befaßt. Für den unbeteiligten Laien stellen sich dann mitunter solche Fragen, ob die Computerfreaks die "Bustreiber" im Stadtverkehr einsetzen oder ob auf der "Europakarte" auch Gebirge und Flüsse eingezeichnet sind.
Ordnung: Chaos im System
Häufig haben sie auch sonst einen ausgefallenen, gehobenen Geschmack, was Kunst, Musik, Literatur betrifft, eine Neigung zum Surrealismus oder Kubismus (vor allem bei den Gehäusen) ist nicht selten. Auffällig ist die im höheren Sinne bestehende Ähnlichkeit ihrer Wohnungen und Zimmer. Diese sind niemals unpersöhnlich wie vielleicht bei Technokraten oder Angestellten. Manche sammeln Antiquitäten, z.B. alte Rechen- oder Schreibmaschinen.
Natürlich herrscht im engeren Aufenthaltsbereich die Technik vor: Man sieht in jedem Fall einen oder mehrere Bildschirme, diverse Tastaturen, vorzugsweise stecken irgendwo Platinen. Die Regale an den Wänden reichen grundsätzlich nicht aus, um die Ordner mit Disketten, Kassetten und Handbüchern zu fassen; auf dem Tisch, am Boden stehen weitere Stapel, dazu Platinen, häufig offenbar nur teilweise bestückt, Vorräte an Draht und Papier, Lötkolben und, daran kann man sie eindeutig von Amateurfunkern unterscheiden: Drucker. Irgendwelche geöffneten, demontierten oder im Aufbau (oder in beiden Stadien gleichzeitig) befindliche Geräte stehen herum. In extremen Fällen gleicht das Gelände einem Truppenübungsplatz im Endstadium. Es türmen sich mehrere Monatsschichten Zeitschriften, Bücher, Schraubenzieher, Unterhosen, Bohrmaschinen, Feilen, Gehäusebauteile und Meßgeräte zu einem Dschungel, in dem ständig etwas gesucht wird (vorzugsweise banales Werkzeug wie Schraubenzieher, dessen Verlust die Arbeit stundenlang aufhält.).
Das ist ihr Ziel
Es ist für den Unverständigen schwer zu begreifen, woran sie eigentlich arbeiten. Befragt man sie, so erhält man übrigens detaillierte und geduldige Auskunft darüber, daß sie an etwas arbeiten, was die unabdingbare Voraussetzung für ein anderes Vorhaben ist, das vielleicht seinerseits nur Mittel zum (zu welchem?) Zweck ist.
Nie findet sie man mit etwas Endgültigem beschäftigt, ja es scheint die Essenz ihres ganzen Strebens zu sein, daß sich alles im Fluß befindet. Vielleicht hat ihr Hobby eigentlich keinen Zweck und ist somit das Edelste überhaupt; sie arbeiten unermüdlich für etwas, daß sie nie erreichen, dem sie nicht einmal nahe kommen, ein Zustand endloser Glückseligkeit.
(nach MC-Sonderheft "Dein Weg zum Computer" Franzis-Verlag 1982, ausgegraben von Ralf Däubner)