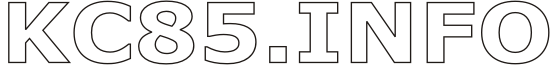TSF99.SSS und die totale Sonnenfinsternis 1999
von Axel Hermann
Am 11.08.1999 wird in Süddeutschland eine totale Sonnenfinsternis zu beobachten sein. Aus diesem aktuellen Anlaß veröffentliche ich ein kleines BASIC-Programm zur Ermittlung und Beachtung von Werten für die Fotografie. Diese Dokumentation ist ausführlich für alle diejenigen, die noch nie Himmelsobjekte fotografiert haben.
Nach Wales und Nordfrankreich verläuft der Schatten von Saarbrücken über Karlsruhe, Stuttgart, Augsburg, München, in Östereich Salzburg, Linz, Graz, den Balaton in Ungarn, Bukarest, Türkei, Iran, Pakistan bis Indien. Von der Küste bis zum thüringer Raum wird die Sonne zwischen 85% und 95% verdeckt.
Nun, da die Unterbringung für mich in Baden-Würtemberg geklärt ist, konnte die Vorbereitung konkrete Gestalt annehmen. Auch für mich ist es die erste Totale und womöglich die letzte, die ich erleben werde, und muß deshalb besonders sorgfältig vorbereitet werden.
Die einzelnen Abschnitte werde ich (und meine Begleitung) mit feststehenden Kameras aufnehmen. Dazu muß für längere Belichtungszeiten die Winkelgeschwindigkeit der Erddrehung beachtet werden. Mit Schrittmotoren mitgeführte Teleskope oder Aufnahmegeräte sind teuer und erfordern eine sehr genaue Justierung des Stativs in Länge und Breite und in Waage zum Untergrund.
Die Winkelgeschwindigkeit ist am (Himmels)äquator am größten, am (Himmels-)Pol gleich 0. Damit sind wir bei der Deklination; sie ist wie auf der Erde die Breitenkoordinate auf Sternkarten. Am 11.8. hat die Sonne eine Deklination von +15,5 Grad (+ = nördl.).
Alles über 50mm (Normalobjektiv) Brennweite sind Teleobjektive, sie vergrößern im Vergleich zum Normal (500mm = 10-fach), aber das Bild wird dunkler. Alles unter 50mm sind Weitwinkel, welche also verkleinern aber eben als Vorteil den Sehwinkel erweitern, das Bild wird heller. Erst ab 28mm und darunter würde ich vom ,,Fischauge`` (extrem Weitwinkel) sprechen.
Bei der Finsternis wird es meist um Vergrößerungen gehen, mit einem 35mm Objektiv werde ich aber auch den Himmel um die total verfinsterte Sonne aufnehmen.
Die Winkel(dreh-)geschwindigkeit der Erde wird durch Teleobjektive verstärkt, Belichtungsobergrenzen also damit verkürzt. Durch die gleichzeitige Verdunklung des Bildes bei immer stärkerer Vergrößerung, was längere Belichtungen erfordert, nähert man sich dieser Obergrenze schnell (oder man ist glücklicher Besitzer lichtstarker Objektive - großer Durchmesser). Hier müssen nun Kompromisse zwischen Brennweite, Helligkeit und Filmempfindlichkeit gefunden werden. Dazu soll das Programm TSF99.SSS dienen. 1000mm (1m) Brennweite bringen eine 20-fache Vergrößerung, das ist schon längst nicht mehr freihand zu halten. In jedem Fall sollte ein Stativ genutzt werden. Während der Bedienung sind immer noch Erschütterungen möglich, deshalb sollte zum Auslösen auch ein Drahtauslöser verwendet werden.
Zur Vergrößerung gibt es im Programm eine interessante Graphik. Das schwarze Fenster hat das gleiche Format wie die Bilder von 24x36mm Filmen. Die Sonne hat am Himmel einen (Winkel-)Durchmesser von ca. 0,5 Grad. Dieser wird als Scheibchengraphik und numerisch in mm (gelb) dargestellt (Zeilen 135 - 155). An den Seiten erscheinen die Himmelsbildausschnitte in Grad (blau, Zeilen 120,125). Danach wird die max. mögliche Belichtungszeit (rot) ohne Berücksichtigung von Helligkeiten angezeigt (Zeilen 210 - 240).
Diese Formel wurde aus der Berechnung der Länge von Strichspuren für 1/100mm (SS, Zeile 220) hergeleitet. Bei Überschreitung der (roten) Zeitangabe kann es also zu Unschärfen wegen der Erddrehung wie beim ,,Verwackeln`` kommen.
Beim Durchspielen verschiedener Brennweiten wird man von der Größe der Sonnenscheibe unter 500mm enttäuscht sein. Dies hat den Grund, daß es sich nur um ein Fokusbild handelt. Dieses wird in einem Teleskop durch das Okular extrem vergrößert. Ein Tele ist ein Teleskop ohne Okular. Auch Konverter sind keine Okulare, sondern Brennweitenverlängerer der Objektive. Ab hier kann also die erste Bestandsaufnahme über vorhandenes Zubehör gemacht werden und ob sich Aufnahmen überhaupt lohnen. Als Minimum empfehle ich 400mm (8- fach), als Maximum 1500mm (30-fach). Bei 2000mm (40-fach) füllt die Sonnenscheibe das Filmbild nahezu aus, von der umgebenden Korona fehlt dann ein großer Teil und durch Helligkeitsprobleme gibt es Belichtungsschwierigkeiten.
Im letzten Teil werden die Filmempfindlichkeit in ASA und ein Belichtungsfaktor K abgefragt. Beim Vergleich der beiden Zeiten ist zu erkennen, ob die rote Zeit überschritten wird; dann muß eine Option geändert werden.
Auch heute gilt noch, höherempfindliches Material ist grobkörnig, so daß bei geringer Vergrößerung die Details verschwinden. SW-Filme sind weitaus kontraststärker. Da zu jeder Zeit vor und nach der Totalität Filter verwendet werden müssen, die die Farben verfälschen, sind Farbfilme nicht unbedingt zu empfehlen! Auch bei der Entwicklung werden die Farben solcher Bilder meist verfälscht. Im Fachhandel gibt es preiswerte Sonnenfilterfolien als Meterware, welche zugeschnitten unter den Glasklemmringen anderer Filter befestigt werden können.
Der Faktor K ist stark wetterabhängig und damit fast reine Erfahrung. Hier einige Richtwerte:
| Flächenobjekte | K-Faktor |
| Sonne | 10.000.000 - 70.000.000 |
| Protuberanzen | 100 |
| Korona | 25 - 50 (etwa Halbmond) |
| Vollmond | 200 - 220 |
| Mond 10 Tage (nach Neumond) | 40 - 80 |
| Mond 7 Tage | 20 - 40 |
| Mond 2 Tage | 2 - 10 |
| Mondfinsternis (total) | 0,005 |
| Aschgraues Mondlicht | 0,01 (schmale Sichel) |
| Punktobjekte | K-Faktor |
| Venus | 200 - 400 |
| Jupiter | 50 - 120 |
| Mars | 20 - 40 |
| Saturn (hellste Sterne) | 10 |
| Uranus | 4 |
| Orionnebel | 0,001 |
| Dunkler Himmel (ohne Mond) | 0,000.002 |
Bei der Totalität ist es dunkel wie bei Vollmond, dafür sollten einige Testaufnahmen mit Notierung aller Werte angefertigt werden. Den Mond mal getrost reichlich überbelichten, so daß auch Sterne sichtbar werden, ohne Vergrößerung. Von einigen Laboren werden solche Bilder (wegen scheinbar leerer Filme) nicht entwickelt, also vorher darauf hinweisen.
Für andere Objekte muß die Konstante 0.52594 in Zeile 150 (Winkeldurchmesser der Sonne in Grad) und ihr halber Wert in Zeile 135 als Variable geändert und durch ein INPUT (Zeile 150) eingegeben werden. Die WD und die Deklinationen anderer Objekte sind astronomischen Jahrbüchern zu entnehmen.