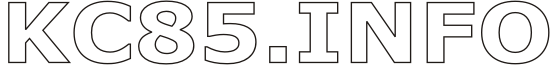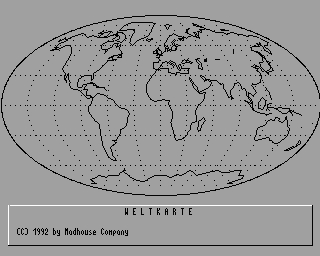KC-Software auf CD-ROM
von Ralf Däubner
Nachdem bereits in den letzten KC-News von der KC-CD berichtet wurde, möchte ich Euch ein paar kleine Details verraten, wie diese CD entstanden ist.
Man schließt eine Audio-Quelle an eine Soundkarte an (ob ein angebissener Apfel oder ein schwindeliger PC oder vielleicht ein Pinguin herumtollt, tut nichts zur Sache). Mit einem WasAuchImmer tut man sich sicherlich wesentlich leichter bei der Audionachbearbeitung. So dürfte es so ziemlich für jedes gängige Betriebssystem ein Tool zum Nachbearbeiten geben. In meinem Fall standen eine AWE 64 zur verfügung. Der PC dazu ist für diese Aufgabe regelrecht unterfordert, wenn es nur ums Aufnehmen geht, reicht noch mein 386er mit der SB16.
Nun das mit dem Aufnehmen ist leichter gesagt als getan. Das Problem ist das Audiosignal, das der Computer (KC; ZX81) lesen muß. In dem Falle ist eine Übersteuerung erwünscht, damit das Audiosignal eindeutige Flanken hat. Nur diese Flanken kann die Laderoutine auswerten. Bei einer Musikaufnahme ist eine Übersteuerung nicht erwünscht, da es dann zu Verzerrungen und einen erhöhten Klirrfaktor kommt. Aus diesem Grund gab es zumindest zum KC extra die Geräte LCR-Data und Geracord GC6022 (von der Monovariante 6020 abgeleitet). Wer das Systemhandbuch zur Hand hat, sollte sich die Sache mit dem Recorder mal durchlesen. Die Ausgangsspannung beträgt bei meinem LCR-Data tatsächlich 250 mV (500 mV Spitze-Spitze). Versuche haben gezeigt, das es mit der Einstellung nicht so einfach ist.
Nun, der CD-Player wird sozusagen der Recorder im übertragenen Sinne, nur Aufnehmen ist leider nicht direkt möglich. Mittlerweile gibt es auf dem HiFi-Sektor doch einige recht brauchbare Alternativen. Das mit der CD haben wir schon. Dann gibt es noch von der Firma Sony die MiniDisk. Diese wiederbeschreibbaren sehr kompakten CDs sind zwar was die Beschichtung betrifft auch magnetischer Natur, aber die werden mit einem Laser abgetastet. Die dazugehörigen Geräte sind mehr oder weniger kompakt aufgebaut, je nach Einsatzbereich. Worauf es eigentlich ankommt, wissen wir bereits.
Jetzt käme von Euch die vielleicht wichtigste Frage. Nun, um sie zu beantworten, müßen wir uns etwas mit den physikalischen Eigenheiten eines Stereogerätes beschäftigen. Denn auch wenn man mono aufnimmt, hat man immer noch ein Stereogerät vor sich. Der Begriff der Schwebung dürfte noch aus dem Physikunterricht bekannt sein, das ist ja das eigentliche Problem, das umgangen werden muß. Eigentlich sehr einfach und naheliegend: Man nutzt anschlußtechnisch einen Kanal; welcher ist dabei Euch überlassen. Bei der Wiedergabe empfehle ich eine Stereoklinke zu nutzen, bei der der linke Kanal unbeschaltet bleibt.
Die Lautstärkeeinstellung ist dann durch Versuch zu ermitteln. Der KC ist da nicht so eigen und das aufgezeichnete Signal ist schon übersteuert. Wichtig ist aber dann, das eventuelle Klangregelnetzwerke deaktiviert werden. Sie verfälschen das Signal ziemlich stark. Meine Versuche habe ich mit einem einfachen CD-Player gemacht. Eventuell könnte das CD-ROM-Laufwerk auch für diesem Zweck genutzt werden. Zu DDR-Zeiten wurden schließlich auch Schallplatten gepresst und die nicht nur für den KC. Damit hätten wir vorerst das Thema Wiedergabe abgeschlossen, kommen wir nun zur Aufnahme.
Weiter oben habe ich bereits alles Wesentliche zum Signal gesagt. Der KC ist von Prinzip her direkt mit der Soundkarte verbunden. Ein kleiner Verstärker paßt die Impendanzen an. Ansonsten müßte ich das Signal lautstärkemässig nachbearbeiten. Aber es kommt wahrscheinlich sehr stark auf die verwendeten Karte an, ich bevorzuge Karten der Firma Creative. Beigepackt ist das relativ anspruchslose Tool WaveStudio. Damit wurden mit minimalsten Einstellungen die Aufnahmen gemacht. Wie schon gesagt, ein 386er macht das Gleiche genausogut.
Als Copy-Tools nutze ich im allgemeinen KC-Kupfer und Copy von Mario Leubner. In letzter Zeit gehe ich wieder den Umweg über das Band, da ich so testen kann, ob das Programm noch funktioniert. Das Dumme an diesem beiden Progs ist, daß ich nur MC-Programme damit kopieren kann. Bei BASIC kommt man nicht am Interpreter vorbei.
Eine reine Basic-CD ist aber schon in Planung. Ich hoffe, daß ich die schon zum Clubtreffen vorstellen kann. Aber als erstes hat die Anwendungs-CD Vorrang. Spiele-CDs gibt es schon 2 Stück (eine gemischte und eine speziell nur für den KC85/3). Vorteil der CD ist eigentlich, daß das Suchen weitestgehend entfällt. Aber die Ladezeiten bleiben leider noch. Der Verstärker, den ich in der Ausgabe 3/2000 als Übung eingescannt habe, läßt sich für jedes Gerät verwenden.
Das Brennen der CD, was gibt es dazu noch zu sagen. Außer, daß ich Audio-CDs nur mit 2-facher Geschwindigkeit brenne, da es sonst zu Schreibfehlern kommt. Nicht daß die CD dann Schrott ist, nein, es ist so, daß das Audiosignal Fehler enthält, wenn sie mit 4-facher Geschwindigkeit oder noch höher gebrannt wird. Sie würde Springen (die Fehlerkorrektur ist dann regelrecht überfordert).
Fazit: Die CD ersetzt leider nicht die Kassette, sie ergänzt nur. Der eigentliche Grund war nur der, daß es schon öfters Anfragen gab, was ein KC so kann. Eine CD ist schnell gebrannt und die Anschußbedingungen sind wirklich minimal. Mit der Mini-Disc gibt es noch eine richtige Alternative, was die Haltbarkeit betrifft. Andererseits gibt es Geräte, wo an Diskette nicht zu denken ist, da sie vom Hersteller zum damaligen Zeitpunkt nicht vorgesehen war.
Audiozusatzschaltung
Bestimmt habt Ihr den Verstärker aus den letzten News über UNIPIC ausgedruckt. Der Artikel dazu erschien in der Practic 1/89. Der Autor war ein Herr Wolfgang Bönisch. Nun hier der ungekürzte Artikel:
- Ein kleines Zusatzgerät kann bei Computerklubs und in Bildungseinrichtungen (Berufsschulen) helfen, fehlerhafte Software sicher einzulesen. Ein Operationsverstärker arbeitet als Schwellwertschalter. Mit dem Regler R5 wird die untere Empfindlichkeitsgrenze eingestellt. Störgeräusche, wie das Rauschen vom Tonband, können damit ausgeblendet werden. Der OPV arbeitet negierend, deshalb folgt ein Inverter (D100, 7400, DL104, DL000). Mit dem Regler R6 erfolgt die Anpassung an den Rechner.
Diese Schaltung generiert ein echtes Rechtecksignal. Sie ist leicht auf einer Lochrasterplatte aufzubauen, die meisten Bauteile finden sich sicher in der Bastelkiste. Der KC 85/2-4 besitzt eine änliche Schaltung, nur nicht so komfortabel. Mit etwas Bastelei läßt sich diese vielleicht sogar im Computer unterbringen.
Tapemaster
Bei meinem Streifzug durch die Emulator-CD (aus dem KC-Archiv) bin ich auf das Programm Tapemaster für den KC 85/3 gestoßen. Dieses lag als Tapeversion (als was sonst) vor. Nun das konnte man auch auf einem M025 verewigen (mit dem EPROM-Brenner M030 ist das wirklich umständlich, aber es geht!). Wer selbst noch ein KC85/3 im Einsatz hat, weiß, was das für ein Programm ist. Lauffähig ist das ab der Adresse C000h, also dort, wo der BASIC-EPROM sich verkrümelt. Um die ewige Schalterei sich zu beenden, war dieses kleine Listing vorgesetzt. Dieses schaltet den BASIC-EPROM ab und aktiviert ein M022 im Schacht 8 (Standard beim /3) auf besagter Adresse. Dazu auch etwas Originaltext aus der Anleitung:
- Mit dem folgenden kleinen Programm kann man sich die doch recht aufwendige Schalterei bei Verwendung eines 16K-RAM-Moduls im Schacht 8 für das Programm TAPE ersparen. Nach Eingabe von TAPE wird es dann ergänzt und mit SAVE 3FD0 5D05 3FDE abgespeichert. Das M022 muß dann auf die Basisadresse 4000H geswitcht werden, was nach Einschalten des Rechners automatisch passiert. Das Zusatzprogramm startet TAPE in RAM-Ebene 2 (erster 32K-Block im gesteckten 64K- oder 256K-Modul im Schacht 0C oder höher), falls diese nicht vorhanden ist, in Ebene 1 (Grundgerät-RAM).
2400 ORG 03FDEH 3FDE UP EQU 0F003H ;PV 1 3FDE 3E 03 START LD A,3 3FE0 2E 02 LD L,2 ;Schacht 2 3FE2 16 00 LD D,0 ;BASIC-ROM aus 3FE4 CD 03 F0 CALL UP 3FE7 26 DEFB 26H 3FE8 3E 03 LD A,3 3FEA 2E 08 LD L,8 ;Schacht 8 3FEC 16 C1 LD D,0C1H ;TAPE auf 0C000H 3FEE CD 03 F0 CALL UP ;und als ROM 3FF1 26 DEFB 26H 3FF2 3E 01 LD A,1 3FF4 32 81 B7 LD (0B781H),A ;ARGN=1 3FF7 21 02 00 LD HL,2 ;Dateinummer fuer 3FFA 22 82 B7 LD (0B782H),HL ;Start in ARG1 3FFD C3 70 CB JP 0CD62H ;Ansprung TAPE
Diese kleine Routine ist was für dem experimentierfreudigen Programmierer. Das Programm selbst habe ich zum Ausprobieren in einen 2764 (damit habe ich den BASIC-ROM eines KC85/3 ersetzt) und in 4 Stück 2716 gebrannt. Die baugleichen russischen Modelle K573rf2, die sich häufig in den EPROM-Modulen befinden, vertragen eine Programmierspannung von 25 V. Die K573rf1 entsprechen den nicht mehr gebräuchlichen 2708. Die letzte Ziffer ist die wichtigste.
Zum Schluß
Und bevor ich es noch vergesse, ein kleines Programm gibt es dieses Mal auch. Es heißt SOUND.KCC. Wie es bedient wird, weiß ich leider nicht, aber ich fand es witzig. Viel Spaß beim Musizieren ;--)